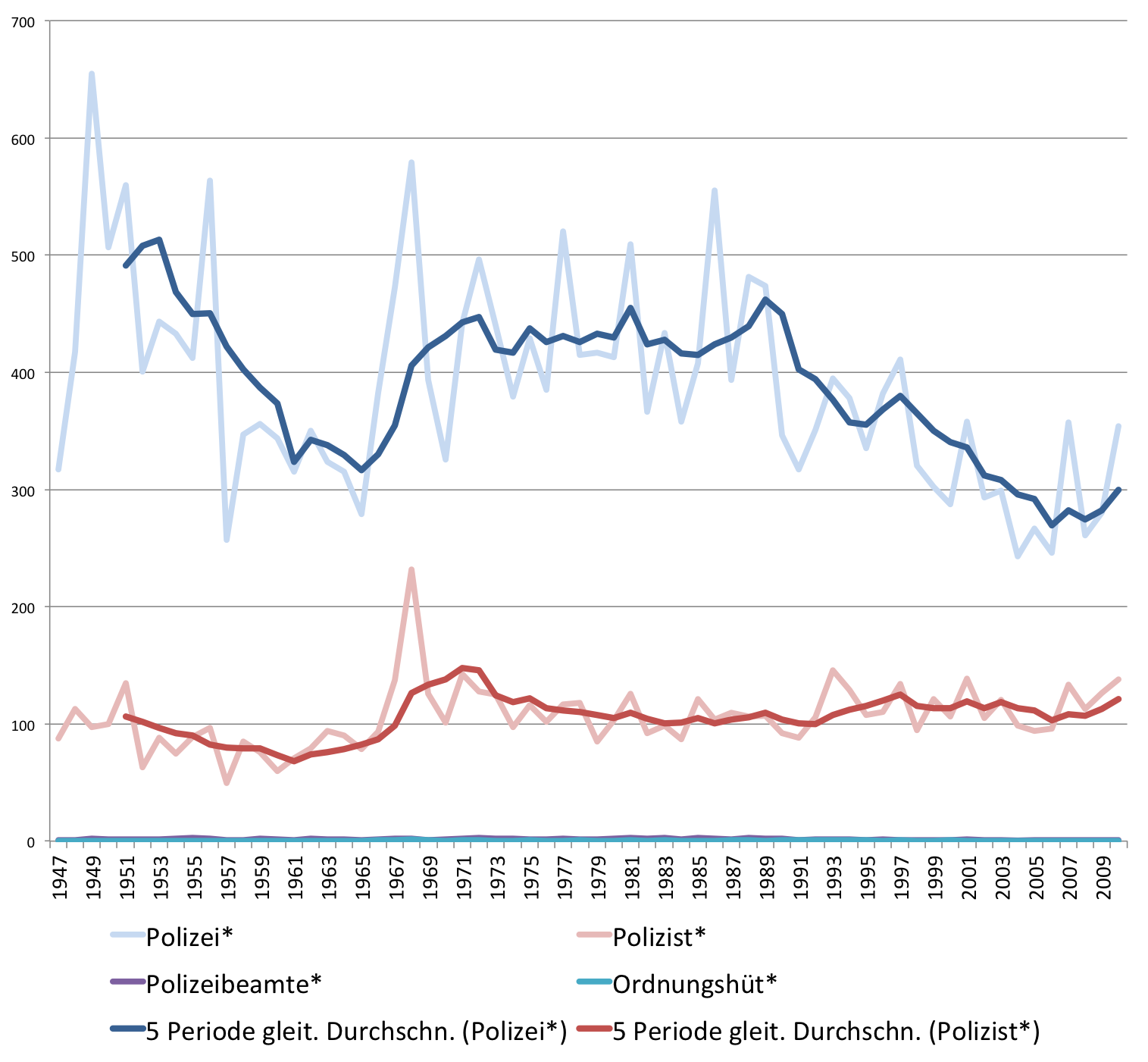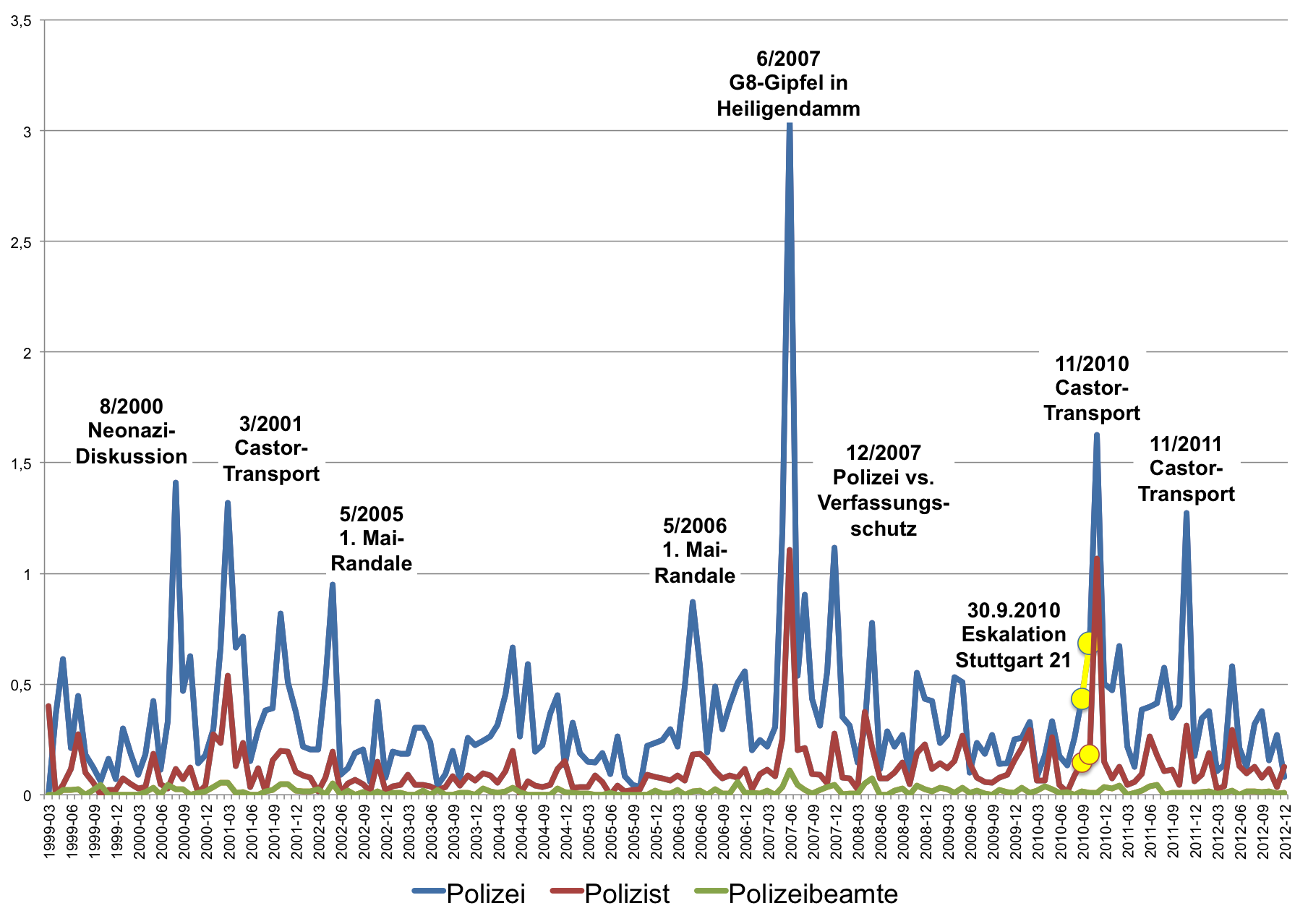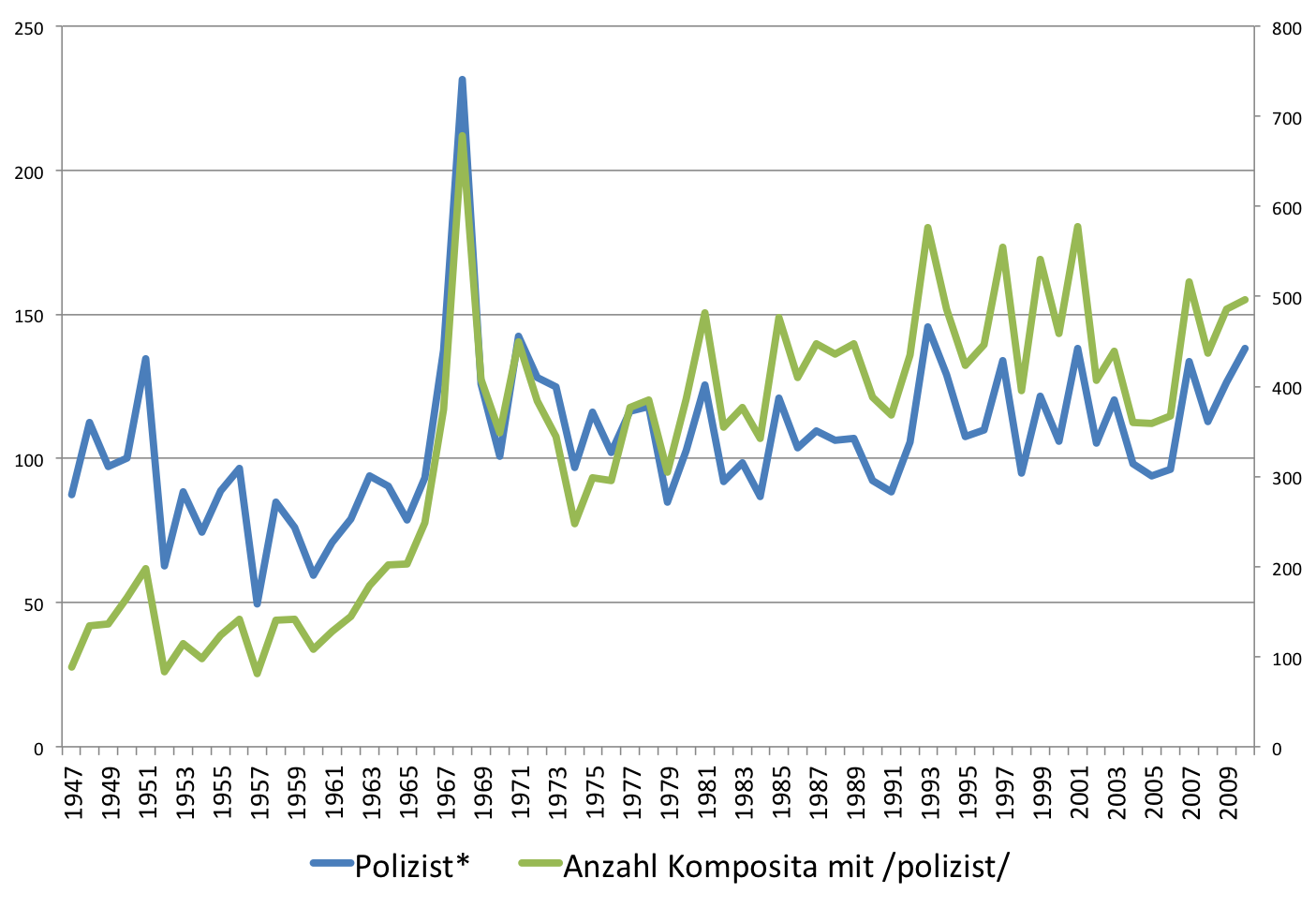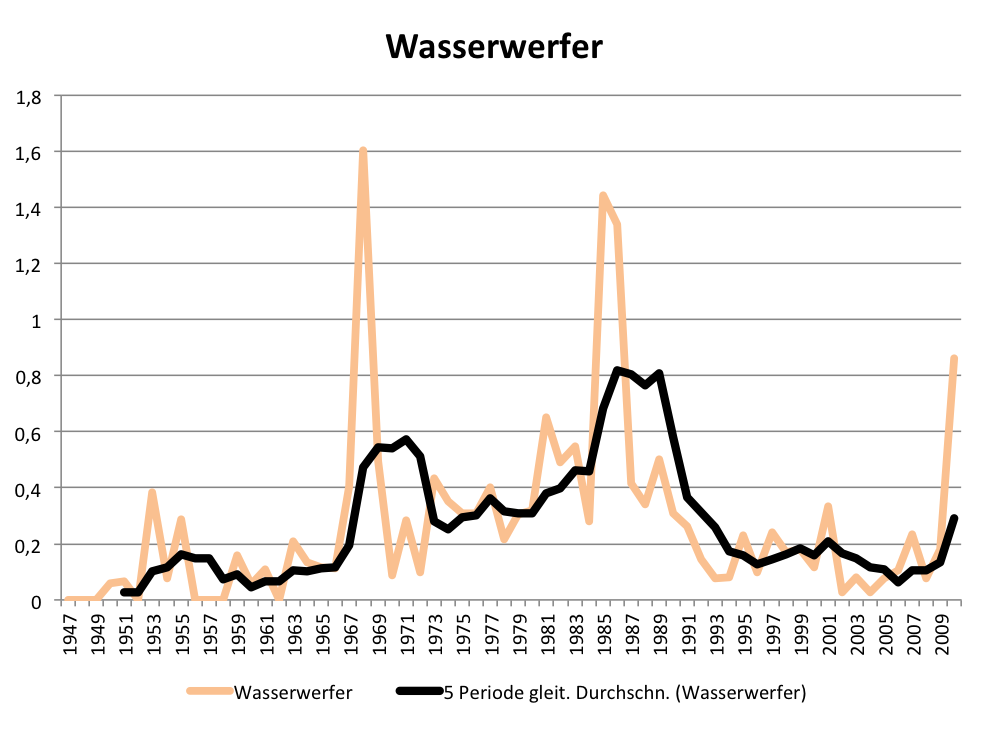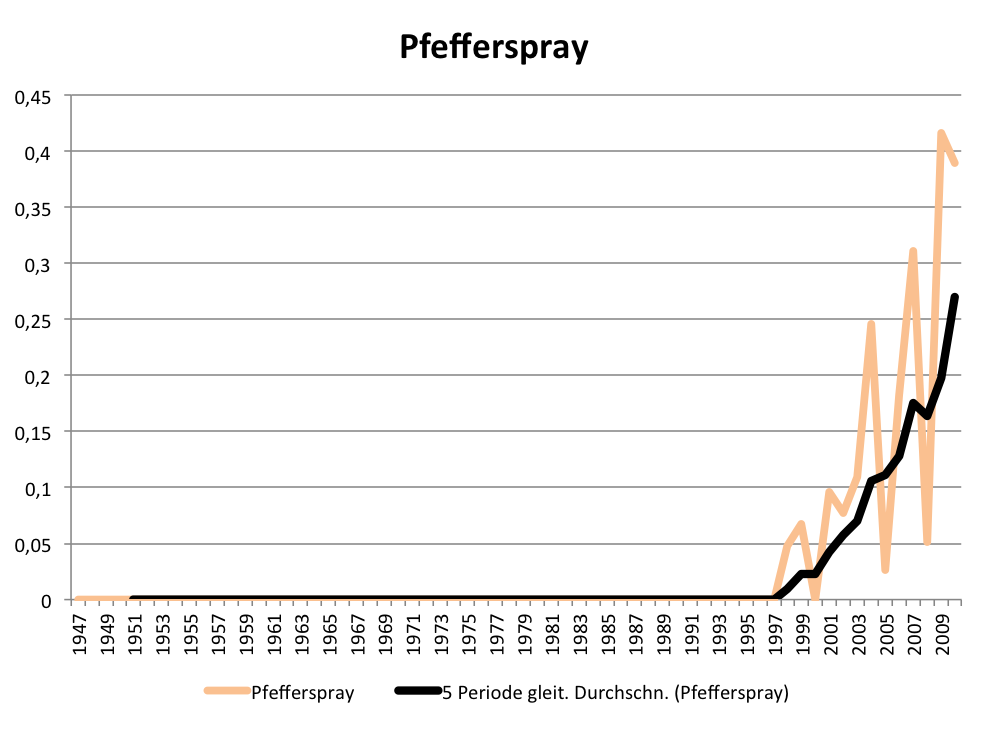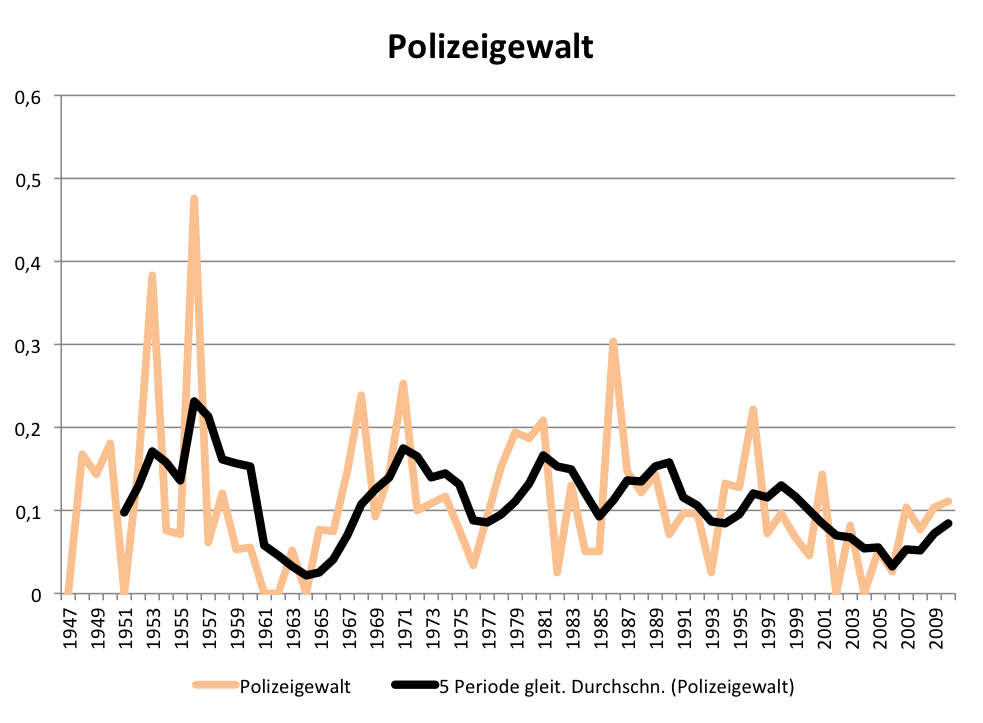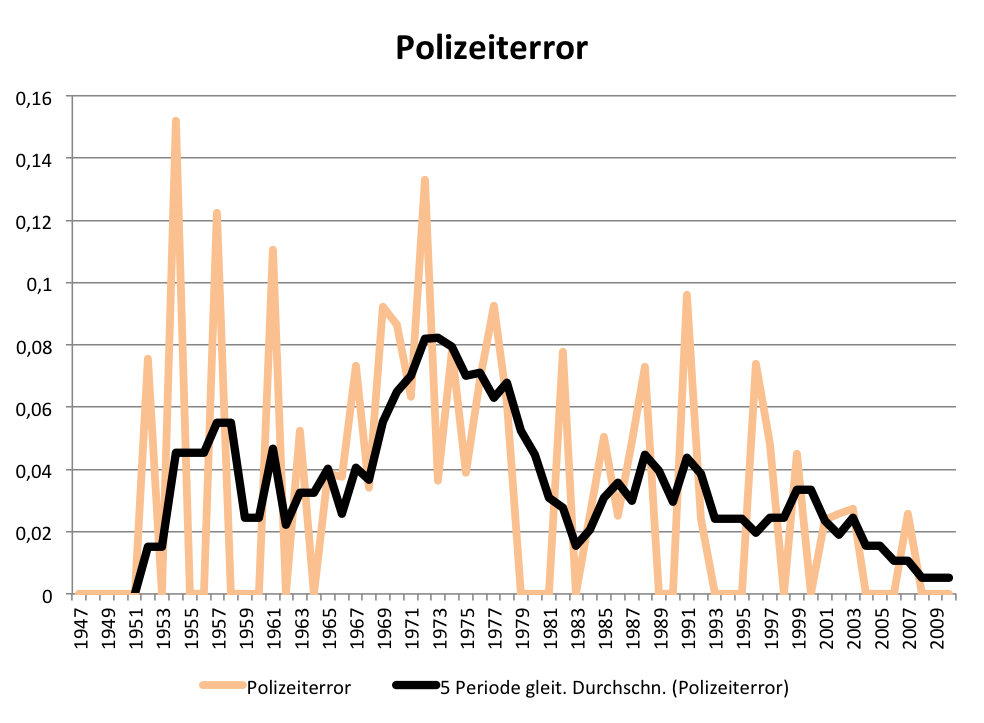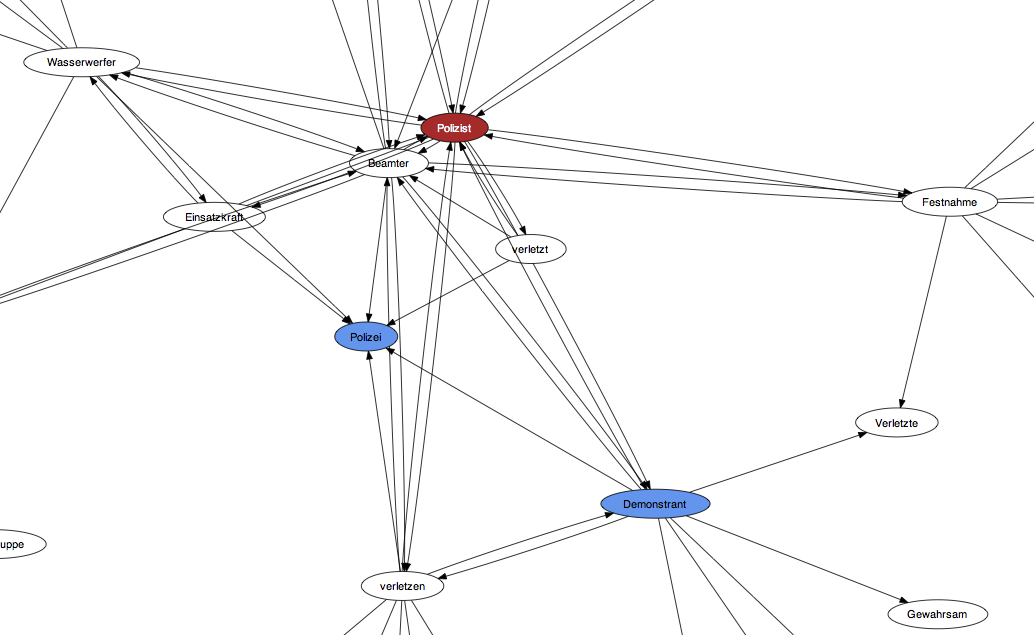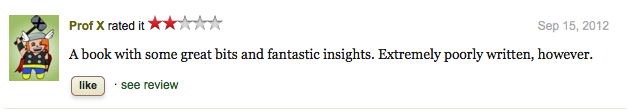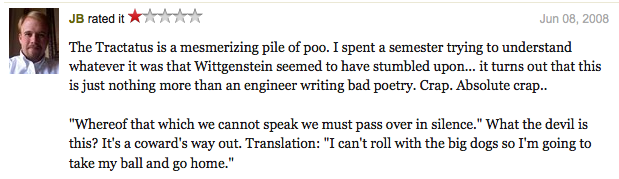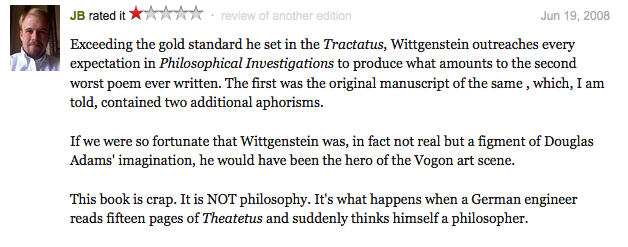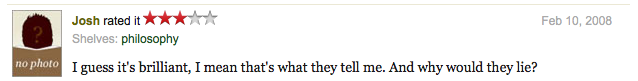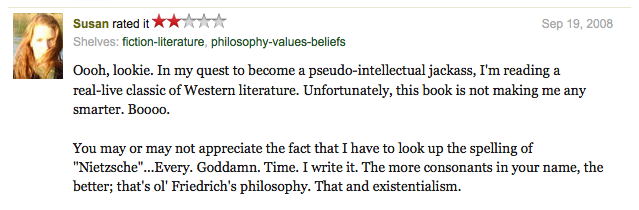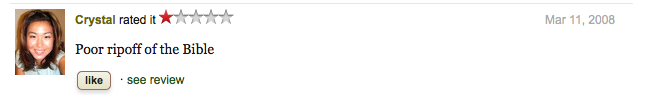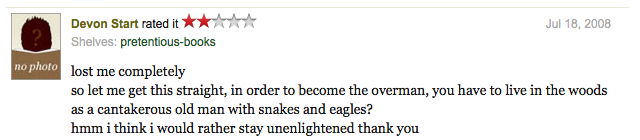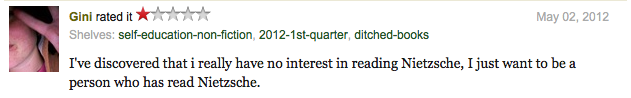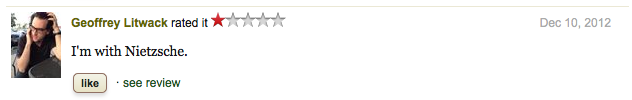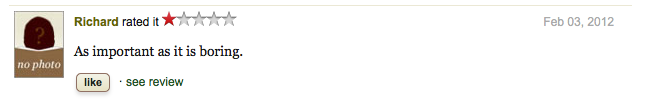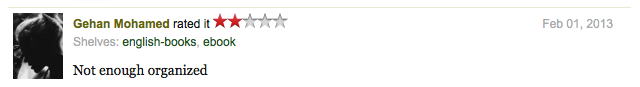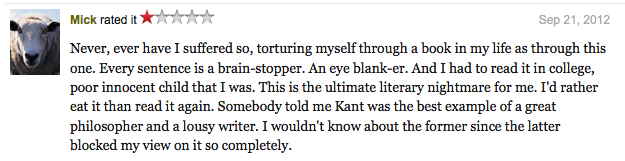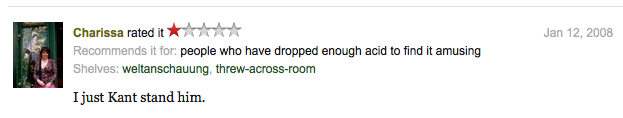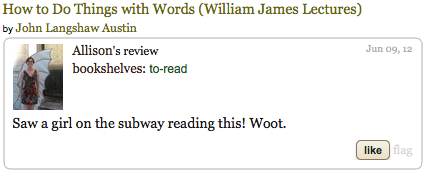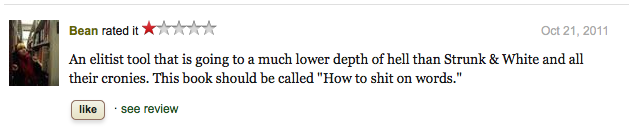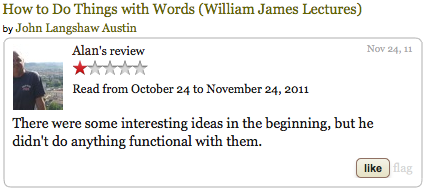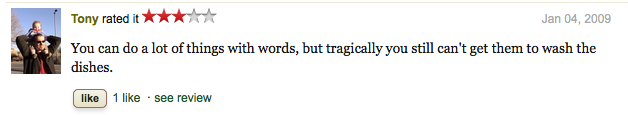Das Plagiat ist wie der Schimmel auf der Käserinde. Man könnte die Rinde wegschneiden und den Käse essen, wenn er denn gut ist. Aber der Ekel und die Vermutung, der Schimmel habe den ganzen Käse verdorben, lässt ihn uns wegwerfen. In der Wissenschaft manifestieren sich Plagiate in fehlenden Fußnoten oder Anführungszeichen. Die Fußnote hätte auf einen früheren Text verweisen sollen, in dem der Gedanke, den sich die vorliegende Studie zu eigen macht, in den gleichen oder anderen Worten, schon einmal oder gar zum ersten mal formuliert ist. Aber auch hier gibt es Grenzen: Natürlich muss man nicht auf die „Kritik der reinen Vernunft“ verweisen, wenn man das Wort „Transzendentalphilosophie“ benutzt. Die Fachkollegen würden schmunzeln.
Die meisten Plagiate in den Kultur- und Sozialwissenschaften (das ist meine Erfahrung mit studentischen Hausarbeiten) treten in jenen Teilen der Arbeit auf, in denen Forschungsgeschichte referiert, Konzepte spezifiziert und Theorien dargestellt werden. Dann wird mangels gründlicher Rezeption der relevanten Texte aus allerlei Sekundärquellen eine auf Kohärenz zielende Darstellung zusammenkomponiert. Und weil es peinlich wäre, die mangelnde Lektüre zuzugeben und „zitiert nach“ zu schreiben, und zu gewagt, die Paraphrase der Sekundärquelle noch einmal durch eine eigene Paraphrase wiederzugeben, tut man so, als habe man das Werk selbst gelesen oder übernimmt wörtlich aus einer Sekundärquelle und lässt den Nachweis weg. Kein Zweifel: Leser und Leserin werden so auf inakzeptable Weise getäuscht.
Wer die Lektüre wichtiger Quellen und Sekundärquellen nur vortäuscht, so könnte man meinen, kann auch keine gute Arbeit schreiben. Stimmt aber leider nicht. Freilich, die guten Studierenden sind klug genug, nicht zu plagiieren. Dennoch erweisen sich bisweilen auch gut oder gar sehr gute Arbeiten als Plagiatsfälle. Die Betreffenden hatten die Theorien, die sie plagiierend referierten, auch ohne vertiefte Lektüre der relevanten Texte verstanden. Und sie waren in der Lage, darauf aufbauend eigenständig zu forschen und neue Erkenntnisse zu generieren. Der Schimmel ist „nur“ auf der Käserinde, den Käse selbst könnten wir eigentlich essen, wenn da nicht unser Ekel wäre.
Bei der Diskussion um Plagiate tritt häufig in den Hintergrund, dass es die eigenständige Denkleistung der Forschenden ist, der Erkenntnissgewinn im Verhältnis zu anderen Arbeiten, der die eigentliche wissenschaftliche Leistung ausmacht. Dennoch ist die Täuschung, vor allem dann, wenn sie gehäuft und systematisch erfolgt, inakzeptabel.
Die utopische Lösung ist, die Täuschung abzuschaffen und mit ihr die Flüchtigkeit, die Ungenauigkeit, die handwerklichen Fehler und was sonst alles noch als Ausrede dafür herhalten muss, wenn Fußnote oder Anführungszeichen fehlen. Die Lösung wäre es, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Zitieren und Verweisen zu entlasten. Sie müssten es nicht mehr selber tun dürfen, sondern die Verantwortung an eine Software abgeben müssen. Eine Software, die in einem fertigen Text vor der Publikation alle intertextuellen Bezüge annotieren würde. Die Software müsste besser sein, als die momentan verfügbare Plagiatssoftware, denn sie müsste über die sprachliche Oberfläche hinaus Konzepte und Argumentationsmuster identifizieren und mit einander in Beziehung setzen können. Das ist zurzeit leider utopisch. Und sie müsste sich auf das Gesamtarchiv aller (wissenschaftsaffinen) Texte stützen können. Auch das ist angesichts des geltenden Urheberrechts leider utopisch. Der Zitationsgraph, dessen Granularität man je nach Erkenntnisinteresse regulieren könnte, wäre wissenschaftshistorisch hochinteressant. Und wenn eine Arbeit nur aus Zitaten früherer Werke zusammengestoppelt wäre ohne den Funken einer eigenen Erkenntnis, dann würde sie auch keinen interessieren. Der Käse wäre ungenießbar, aber nicht wegen des Schimmels auf der Rinde.
Leider werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber auch weiterhin einen gewichtigen Teil ihrer Ressourcen in die Pflege von Literaturdatenbanken und Fußnotenapparaten investieren, Plagiatsjäger ihre Freizeit in das Auffinden für Indizien von Täuschungsabsichten und Fakultäten viel Geld in Lizenzen für Plagiatssoftware.